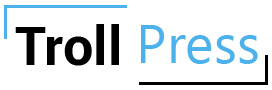AfD, Ukip, FPÖ, Front National – fast überall sind die Rechtspopulisten auf dem Vormarsch. Jetzt wurde Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt. Erst kam die Politikverdrossenheit, dann der Rechtspopulismus. Bei vielen Menschen wächst das Gefühl, dass die Politiker ihres Landes mit den eigenen Bedürfnissen nicht mehr viel zu tun haben und dass Politik immer mehr zum Wahlkampf verkommt.
Einige Wissenschaftler und Autoren plädieren daher für eine Alternative zu unserem Wahlsystem, die sie für demokratischer halten und die erstmal befremdlich klingt: Politik durch Losverfahren. Die Idee: Ganz normale Bürger werden Gremien zugelost, die sich mit Hilfe von Dokumenten und Experten zu einem Thema informieren, beraten und schließlich Entscheidungen fällen oder Entscheidungsvorschläge machen. Anders als bei einem gewöhnlichen Referendum, wo oft mit nur oberflächlichem Wissen über etwas abgestimmt wird und das Manipulationsrisiko hoch ist, soll hier fundiertes Wissen vermittelt und ein sachlicher Diskurs gefördert werden. Befürworter versprechen sich davon, die politische Klasse als Elite zu überwinden, Korruption und Profilierungsdrang entgegenzuwirken und die Politik wieder volksnäher zu machen.
Die Soziologin Christiane Bender, die an der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg lehrt, hat sich gemeinsam mit ihrem Kollegen Hans Graßl von der Universität Siegen mit den Vor- und Nachteilen eines solchen Verfahrens beschäftigt.
Frau Bender, die US-Amerikaner haben Donald Trump zum Präsidenten gewählt. Hat Sie das überrascht?
Nein, es hat mich gar nicht überrascht. In den USA gibt es Teile der Bevölkerung, die sich vom politischen System nicht repräsentiert fühlen. Und das entspricht ja auch den Tatsachen. Ökonomisch, politisch und kulturell kommen bestimmte Gruppen wenig bis gar nicht zu Wort. Das zeigt sich sowohl in der Sympathie für Bernie Sanders wie auch bei Donald Trump: Dass diese Menschen jemanden suchen, der ihre Sprache spricht, von dem sie sich erhoffen, dass er ihnen eine Stimme verleiht. Das ist eine Entwicklung, wie wir sie auch in Europa sehen. Das politische Establishment hat sich abgekoppelt von der Lebenswirklichkeit bestimmter Schichten.
Trump in Amerika, die AfD hierzulande, dazu Front National, FPÖ – die Rechtspopulisten scheinen überall auf dem Vormarsch. Steckt die Demokratie in der Krise?
Ja, denn die Demokratie lebt davon, dass das Volk sich am politischen Geschehen beteiligt. Aber inzwischen sind normale Menschen nicht mehr sichtbar im politischen Betrieb. Ein Teil der Bevölkerung findet keinen Zugang mehr zu den Organen der Demokratie, in denen die Gespräche und Diskurse über die Entwicklung des Landes stattfinden. Die Demokratie in Deutschland nach 1945 ist deshalb zur Erfolgsgeschichte geworden, weil in Parteien und Verbänden Menschen aus den verschiedensten Schichten tätig waren und sich mitgenommen fühlten. Sonst hätte es nicht funktioniert.
Woran liegt das, dass sich heute so viele Menschen abgekoppelt fühlen?
Das liegt auch am Versagen der Volksparteien, wenn es darum geht, sich um ihre Wähler an der Basis zu kümmern. Führungspersonen in Parteien wählen häufig Menschen in die Gremien, die ihren Vorstellungen entsprechen. Wer zum Beispiel keinen akademischen Abschluss hat, hat es heutzutage schwer. Und wenn man jetzt an die Politiker der Volksparteien denkt, zum Beispiel die der SPD: Deren Kinder haben im Zuge der Bildungsexpansion oft selbst einen sozialen Aufstieg durchlaufen. Aber nicht alle haben den Aufstieg geschafft. Und diese Menschen fallen dann heraus.
Das ist es auch, was viele Hillary Clinton in den USA vorgeworfen haben: Dass sie für ein abgehobenes Establishment steht.
Ja, und man sagt auch, dass sie zu wenig oder gar nicht bei Menschen aufgetreten ist, die etwa ihre Arbeit verloren haben. Sie hat sich nicht bemüht, konkret mit ihnen über ihre Lebensverhältnisse zu sprechen. Was sie sagte, klang immer sehr glatt.
Und warum glauben diese Leute dann, dass ausgerechnet der reiche Donald Trump ihnen eine Stimme verleihen kann?
Wir haben in der Geschichte häufig beobachtet, dass eine Person immensen Zulauf erhält, die ein gewisses Charisma hat und beansprucht, die Lebensverhältnisse dieser Menschen zu kennen. Die wird dann als Gegenmodell gewählt. Das heißt nicht, dass ein solcher „Volkstribun“ wirklich die Interessen der Menschen vertritt, die ihn gewählt haben. Aber je mehr das Establishment mit Verachtung auf Trump reagiert hat, darauf etwa, wie er spricht und was er sagt – desto mehr hat er Wähler für sich gewinnen können. Weil sie sich mit der Verachtung, die ihm entgegengebracht wurde, identifizieren. Das sind Gruppen, die in der Globalisierung Verluste erleiden, etwa in Form von Arbeitsplätzen, die aber nicht in dem Maße an den Gewinnen der Globalisierung durch Konsum oder Reisen teilhaben können wie andere Schichten. Die Elite ist in gewisser Weise unsensibel dafür. Die, die von der Gegenwart profitieren, haben ja oft gar nicht das Gefühl, die anderen mit einbeziehen zu müssen, weil es für sie ganz gut läuft.
Der belgische Autor und Historiker David Van Reybrouck glaubt, dass Wahlen, wie wir sie kennen, die Demokratie behindern – unter anderem, weil Politiker immer auch auf die eigene Wiederwahl hinarbeiten. Er und auch einige Politikwissenschaftler plädieren für eine Alternative: Das Losverfahren. Wie würde das funktionieren?
Das Losverfahren bietet die Chance, den Einfluss des politischen Establishments zu verringern. Es kommt darauf an, wie und worauf es angewandt wird. Beispielsweise in Kanada oder in den Niederlanden gibt es Gremien, die von Bürgern besetzt sind, die dafür ausgelost wurden. Sie sollen für eine begrenzte Zeit einen Auftrag erfüllen und einen Entscheidungsvorschlag ausarbeiten, den sie dann an das Parlament weiterreichen. Manche Befürworter des Verfahrens fordern sogar, alle Mitglieder des Parlaments auslosen zu lassen.
Welche Vorteile hätte das?
Man möchte dort Menschen aus dem Volk haben, die nicht in diesem verengten Betrieb sozialisiert und geschult wurden. Im Grunde ist das eine revolutionäre Idee. In einem echten Losverfahren entscheidet allein der Zufall. Diese Vorstellung bekommt vor allem dann Zustimmung, wenn man bemerkt, dass ein Teil der Bevölkerung keine Stimme mehr in den Parteien, den Medien, der Kultur hat.
Und welche Nachteile hätte das Verfahren?
Die Vorstellung einiger Befürworter ist es, beim Losverfahren bewusst einen Querschnitt der Bevölkerung zu bilden. Aber wenn man explizit Vertreter aus allen gesellschaftlichen Gruppen haben will, müsste man im Vorfeld schon Gruppen bilden, aus denen dann Vertreter ausgelost werden. Das halte ich für keine gute Idee. Wenn alle Abgeordneten im Parlament durch Losen bestimmt würden, bedeutet das außerdem, dass die Bürger und Bürgerinnen sich für niemanden bewusst entscheiden können, sie zu vertreten. Freie Wahlen sind eine großartige Erfindung und gehören zur Demokratie. Beim Losverfahren können die Wähler sich jedoch kaum über die Abgeordneten informieren. Der Vorzug etwa des deutschen Systems ist, dass die Parteien auf bestimmte Programme festgelegt sind. Die Bürger können einer Partei einen Wählerauftrag geben, sie dann daran messen, was sie leistet – und sie auch gezielt wieder abwählen. Wenn man das gesamte Personal auslost, würde das sehr viel schwieriger sein.
Was würden Sie vorschlagen?
Mein Kollege Hans Graßl und ich haben vor zwei Jahren einen Vorschlag gemacht, der das repräsentative System nicht ersetzen, aber ergänzen würde. Man könnte fünf Prozent der Parlamentssitze an Menschen verlosen, die an der regulären Wahl teilgenommen haben. Wer nicht an der Verlosung teilnehmen will, muss nicht. Die anderen hätten die Chance, für eine Legislaturperiode einen Abgeordnetensitz zu bekommen, mit Bezügen und einem Beraterstab wie die auch anderen Politiker. Sie hätten zwar kein Stimmrecht bei Abstimmungen – das lässt das Grundgesetz nur für gewählte Abgeordnete zu -, würden sich aber dennoch im parlamentarischen Betrieb einbringen. Wir meinen, dass davon eine Signalwirkung ausgehen könnte, dies das politische Interesse belebt. So könnte auch populistischen Bewegungen entgegengewirkt werden. Die Leute müssten nicht mehr nur von außen schimpfen, sondern hätten die Chance, wirklich mitzureden. Zur Demokratie gehört, dass alle dabei sind. Sonst wenden sich die Menschen ab.
Christiane Bender ist seit 2001 Professorin für Soziologie an der Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg. Sie beschäftigt sich unter anderem mit Gesellschaft und Demokratie und dem Verhalten von Eliten. Mit ihrem Kollegen Hans Graßl hat sie 2014 für die Bundeszentrale für politische Bildung den Artikel „Losverfahren: Ein Betrag zur Stärkung der Demokratie?“ verfasst.
Read more on Source